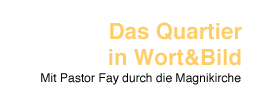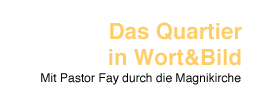Der alte und der neue Altar

 Dann stehen wir im Südschiff vor dem Mittelteil (Torso) des
einstigen barocken Hochaltars (4). Er wurde 1730-1734 von
den Bildhauern Jenner und Vetten aus Blankenburger Marmor
und Alabaster geschaffen. Solche Hochaltäre sind in drei Etagen
gestaltet: Leiden, Kreuzigung und Auferstehung. (Ein vollständig
erhaltenes Ensemble dieser Art bietet der Hochaltar von St.
Martini am Altstadtmarkt.) Die untere Ebene „Leiden“ ist jetzt ein
offener Torbogen. Vor der Kriegszerstörung war hier die Szene
„Jesus im Garten Gethsemane“ als Marmorbild zu sehen. In der
mittleren Ebene finden wir neben dem Gekreuzigten die allegorischen
Frauengestalten „Hoffnung“ (mit Anker) und „Geduld“
(mit Lamm). „Glaube“ (mit Kelch und Diadem) und „Liebe“ (mit
Kind) sind jetzt seitlich aufgestellt - nach 1. Kor. 13,13 und Rom.
5,3-5. Die obere Ebene „Auferstehung“ - gestaltet nach dem
Muster barocker Portalkronen - bleibt im Andeutungshaften:
Engel weisen nach oben und leiten unsere Gedanken über den
Tod hinaus (Joh-Ev. 11,25 f).
Dann stehen wir im Südschiff vor dem Mittelteil (Torso) des
einstigen barocken Hochaltars (4). Er wurde 1730-1734 von
den Bildhauern Jenner und Vetten aus Blankenburger Marmor
und Alabaster geschaffen. Solche Hochaltäre sind in drei Etagen
gestaltet: Leiden, Kreuzigung und Auferstehung. (Ein vollständig
erhaltenes Ensemble dieser Art bietet der Hochaltar von St.
Martini am Altstadtmarkt.) Die untere Ebene „Leiden“ ist jetzt ein
offener Torbogen. Vor der Kriegszerstörung war hier die Szene
„Jesus im Garten Gethsemane“ als Marmorbild zu sehen. In der
mittleren Ebene finden wir neben dem Gekreuzigten die allegorischen
Frauengestalten „Hoffnung“ (mit Anker) und „Geduld“
(mit Lamm). „Glaube“ (mit Kelch und Diadem) und „Liebe“ (mit
Kind) sind jetzt seitlich aufgestellt - nach 1. Kor. 13,13 und Rom.
5,3-5. Die obere Ebene „Auferstehung“ - gestaltet nach dem
Muster barocker Portalkronen - bleibt im Andeutungshaften:
Engel weisen nach oben und leiten unsere Gedanken über den
Tod hinaus (Joh-Ev. 11,25 f).
Ursprünglich stand der Hochaltar in der Chorapsis, erweitert um
zwei Torbögen links und rechts, die beim Abendmahl den Umgang
um einen Altartisch ermöglichten, der mittig vor dem o.g.
Marmorbild stand (d.h. vor dem jetzigen offenen Torbogen). Auf
dem Sims in Höhe der Kreuzigungsdarstellung standen die vier
allegorischen Frauengestalten „Glaube, Hoffnung, Geduld und
Liebe“. Beim Wiederaufbau wurde das Mittelteil des Hochaltars
einem Lettner vergleichbar als „Portal zur Taufe“ an seinen jetzigen
Platz versetzt.
 Nach links gewandt blicken wir über den schlichten Altartisch
(5), 1964 aus einem Block Elmkalkstein gehauen (Entwurf: H.O.
Vogel), auf das den heutigen Kirchraum prägende und die Mitte
weisende Kunstwerk: das Triumphkreuz (6), ein Bronzekruzifix
von Ulrich Henn (1963). Es zeigt Christus als Gekreuzigten und
zugleich Auferstandenen, umgeben von sechs Engeln (Serafim) -
in Anlehnung an die Geschichte von Jesajas Tempelvision
(Jesaja 6). Die Engelgestalten sind von fern als solche nicht
auszumachen und erscheinen wie ein bizarrer Dornenkranz um
den Kreuzesbalken, an dem man auch Jesu Körper im Gegenlicht
der hellen Chorfenster kaum erkennt. Erst aus der Nähe
erblickt man einen Kreis von sechsflügeligen Engeln (nach
den Serafim aus Jesaja 6), die nun den lebendigen Christus
tragen, der uns vom Kreuz aus mit segnender Gebärde grüßt:
der Triumph über den Tod durch die Auferstehung des Gekreuzigten
(1. Kor. 15,55). - So gleicht unser Weg zum Altar einer
Passions-Prozession: von der Feme zur Nähe, von Karfreitag
zu Ostern, von Dornenkrone und Kreuzesbalken zu Engelskranz
und Auferweckung.
Nach links gewandt blicken wir über den schlichten Altartisch
(5), 1964 aus einem Block Elmkalkstein gehauen (Entwurf: H.O.
Vogel), auf das den heutigen Kirchraum prägende und die Mitte
weisende Kunstwerk: das Triumphkreuz (6), ein Bronzekruzifix
von Ulrich Henn (1963). Es zeigt Christus als Gekreuzigten und
zugleich Auferstandenen, umgeben von sechs Engeln (Serafim) -
in Anlehnung an die Geschichte von Jesajas Tempelvision
(Jesaja 6). Die Engelgestalten sind von fern als solche nicht
auszumachen und erscheinen wie ein bizarrer Dornenkranz um
den Kreuzesbalken, an dem man auch Jesu Körper im Gegenlicht
der hellen Chorfenster kaum erkennt. Erst aus der Nähe
erblickt man einen Kreis von sechsflügeligen Engeln (nach
den Serafim aus Jesaja 6), die nun den lebendigen Christus
tragen, der uns vom Kreuz aus mit segnender Gebärde grüßt:
der Triumph über den Tod durch die Auferstehung des Gekreuzigten
(1. Kor. 15,55). - So gleicht unser Weg zum Altar einer
Passions-Prozession: von der Feme zur Nähe, von Karfreitag
zu Ostern, von Dornenkrone und Kreuzesbalken zu Engelskranz
und Auferweckung.
 Diese „Triumphkreuz“ genannten Kruzifixe, gestaltet in der
Doppelaussage von Leiden und Überwindung, Tod und Auferstehung,
stammen aus der Kulturepoche der Romanik:
Christus wird mit königlichen Symbolen dargestellt (Purpurmantel,
Flechthaar, Diadem). Das „Imervard-Kreuz“ im Dom ist
ein bedeutendes Beispiel aus dieser Zeit. Beim „Triumphkreuz“
von St. Magni verbindet sich aber die Anschauung des lebendigen
Christus als „Himmelskönig“ (die Serafim glorifizieren nun
Christus anstelle von Gottes Thron) mit der Eiendsgestalt des
zu seiner Hinrichtung gekreuzigten
Jesus: kahlköpfig und hohlwangig das Haupt - der Körper hager
und nur vom Lendenschurz bedeckt. Das namenlose Leid
aller durch Folter, Haft, Hunger oder Schmerz Geschundenen
ist an diesem Kreuz „erhöht“ und zu neuem Leben hindurchgetragen.
Auch unsere Ängste, Verzweiflung und hoffnungslose
Not, die Verlusterfahrungen und das Erleben unserer Grenzen
durch Krankheit und Tod sind von diesen am Kreuz ausgebreiteten
Armen Christi umfangen, um unser beschädigtes und
unabgefundenes Leben in erfülltes Leben zu wandeln.
Diese „Triumphkreuz“ genannten Kruzifixe, gestaltet in der
Doppelaussage von Leiden und Überwindung, Tod und Auferstehung,
stammen aus der Kulturepoche der Romanik:
Christus wird mit königlichen Symbolen dargestellt (Purpurmantel,
Flechthaar, Diadem). Das „Imervard-Kreuz“ im Dom ist
ein bedeutendes Beispiel aus dieser Zeit. Beim „Triumphkreuz“
von St. Magni verbindet sich aber die Anschauung des lebendigen
Christus als „Himmelskönig“ (die Serafim glorifizieren nun
Christus anstelle von Gottes Thron) mit der Eiendsgestalt des
zu seiner Hinrichtung gekreuzigten
Jesus: kahlköpfig und hohlwangig das Haupt - der Körper hager
und nur vom Lendenschurz bedeckt. Das namenlose Leid
aller durch Folter, Haft, Hunger oder Schmerz Geschundenen
ist an diesem Kreuz „erhöht“ und zu neuem Leben hindurchgetragen.
Auch unsere Ängste, Verzweiflung und hoffnungslose
Not, die Verlusterfahrungen und das Erleben unserer Grenzen
durch Krankheit und Tod sind von diesen am Kreuz ausgebreiteten
Armen Christi umfangen, um unser beschädigtes und
unabgefundenes Leben in erfülltes Leben zu wandeln.
Übersicht | Weiter: Im Taufbereich
|